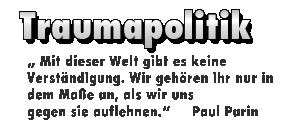von Sepp Graessner
PTSD seems a tailor-made diagnosis for an
age of disenchantment and disillusionment.
(D. Summerfield, 2001)[i]
If mental disorders were listed on the New York exchange,
PTSD would be a growth stock to watch. (P.R. Lees-Haley 1986)[ii]
Einführung:
Manche Denker sagen, die Wissenschaft entdecke eine Welt, die bereits vorhanden ist. Andere wiederum meinen, dass die Wissenschaft in Wirklichkeit gar keine bereits vorhandene Welt entdecke, sondern eine solche Welt (mehr oder weniger) erfinde, besonders wenn es um beobachtete Interdependenzen von und fabrizierte Gesetze für sehr komplexe Phänomene geht.
Das psychische Trauma hat es ja immer schon gegeben, es hieß zumeist Katastrophe, Drama, Unglück, Heimsuchung, Krieg, Willkür und konnte in eine postdramatische Störung münden. Erst seit 35 Jahren existiert mit der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS, PTSD) eine Diagnose, zu der sich die „Erfindergenerationen“ im 19. Jahrhundert noch nicht durchringen konnten, vielleicht weil sie der Meinung waren, dass die posttraumatische Symptomatik keine sicher von anderen psychischen Störungen abgrenzbare Entität sei oder sie andere Traumaaspekte in den Vordergrund rückten oder die traumatische Neurose den Sachverhalt am besten ausdrücke. Sie waren noch der Beschreibung individueller Leidensgeschichten verhaftet, kannten wohl noch nicht die Tücken der Statistik, konnten sich noch auf ihre Beobachtungen verlassen, nahmen ihre Wirkungen bei sich und ihren Patienten ernst und hüteten sich vor allzu schnellen Verallgemeinerungen. Vor allem aber wussten diese Generationen, dass jede neue Begriffsbildung in der Diagnostik ein abstraktes Gebilde ist, das seine Existenz den Teilen verdankt, die ohne explizite Bedeutung oder unbewusst bleiben, so dass man sagen kann, die bewusste „Erfindung“ und der bewusste Gebrauch eines neuen Begriffs macht vieles unbewusst, was in Abgleichungsprozessen unberücksichtigt oder marginal geblieben ist. Daher ist der Begriff PTBS, wenn er denn in der heutigen Form erhalten bleibt, ein stets neu zu belebender Prozess und kein Absolutes oder Wahres. Diese Vorläufigkeit widerspricht zudem dem Universalitätsanspruch der Diagnose, außer man nimmt überall im menschlichen Universum dieselbe Abstraktionsfähigkeit und Bedeutungsaufladung an.
Und obwohl es um diagnostizierbare Veränderungen im menschlichen Organismus, d.h. biologische Prozesse, geht, denen Universalität zugesprochen wird, und nicht allein um abstrakte Begriffe, wird jeder einräumen, dass es ohne Begriffe keine realen Tatsachen gibt, über die und von denen man sprechen kann, d.h. im globalen Maßstab haben diagnostische Begriffe eine je eigene Bedeutung, die vieles ausschließt (was im Lateinischen eine der Bedeutungen von abstrahere ist). Die Etablierung der Diagnose PTBS macht zunehmend Schwierigkeiten, nicht so sehr für PraktikerInnen, die nicht primär die ursprüngliche Konzeption anfechten, sondern einfach anwenden. Forschungsergebnisse weisen jedoch oft in diametral entgegengesetzte Richtungen, so dass die Idee, Lebenswirklichkeit kreiere psychische Leidensphasen, die psychiatrisch erklärbar seien, zunehmend in soziale und enigmatische Kategorien entweicht und zur Ideologie werden kann, weil der wissenschaftliche und der populäre Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung nur scheinbar klar und präzise sind. Vielmehr glauben etliche Forscher, der Begriff sei widersprüchlich, transportiere auch viel Nichtpsychologisches, werde trotz oder wegen der Expansion hohler. Nur hohle Begriffe können ideologisch aufgeladen werden.
Dass negativ definierte menschliche Erlebnisse psychische Schmerzen und äquivalente Empfindungen und Antworten auslösen können, ist evident und unbestreitbar. Je intensiver und verwurzelter diese jedoch in normativen Bahnen verlaufen (sollen), desto so hellhöriger muss eine kritische Öffentlichkeit die Grundlagen der Konzeption in Frage stellen.