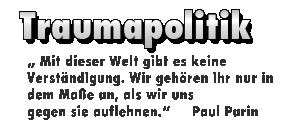Risikofaktoren bei PTSD – Erläuterung zu einer Graphik
von Sepp Graessner
Vorbemerkung
Dieser Aufsatz wird sich mit der Rolle und der katalogischen Erweiterung von Risikofaktoren bei der Ausbildung von posttraumatischen Belastungsstörungen befassen. Unter der Annahme, dass es nicht nur eine Belastungsstörung post Trauma gibt, sondern eine farbige Vielfalt, der man ein Etikett anklebt, soll zudem eine Prüfung der Argumente, des dahinter stehenden Gedankengebäudes und der einfließenden Interessen vorgenommen werden. Es ist allgemein anerkannt, dass es zahlreiche Typen posttraumatischer Befindlichkeiten gibt, die posttraumatische Belastungsstörung (als klinische Diagnose) wäre folglich nur eine gravierende davon. Nur letztere darf sich definitionsgemäß im klinischen Kontext entfalten. Jedoch, es drängen sich, seit die Anerkennung dieser Störung eine Verbindung mit materieller Entschädigung eingegangen ist, die meisten posttraumatischen Störungsbilder unaufhaltsam ins öffentliche Bewusstsein, und sie wünschen, die Diagnose PTSD zugesprochen zu bekommen. Sie ist die Voraussetzung für materielle Entschädigungen. Dies liegt nun vermutlich neben kollektiven Gefühlen von Angst und Unsicherheit und neben diffusen Gerechtigkeitsempfindungen an der Ausweitung von Risikofaktoren, die jenseits von einem traumatischen Ereignis die Entwicklung und Ausprägung einer posttraumatischen Belastungsstörung befördern. Die Vermehrung von einflussreichen Faktoren, die PTSD begünstigen, scheint inzwischen das ursprünglich als ursächlich angenommene traumatische Erleben aus ihrem alleinigen Zuständigkeitsbereich zu verdrängen. Es mündet in die berechtigte Frage: Ist das traumatische Ereignis für die Entwicklung der posttraumatischen Symptomcluster allein verantwortlich oder spielen vortraumatische und/oder posttraumatische Risiken eine wesentliche Rolle? Und was ist hiermit eigentlich gewonnen?