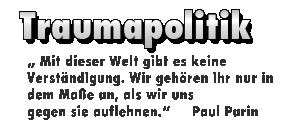Folter, Misshandlung und zur Funktion von Regression
Folter, Misshandlung und zur Funktion von Regression
von Sepp Graessner (2005)
Vor rund 10 Jahren habe ich den folgenden Beitrag geschrieben. Er hat deshalb nicht an Aktualität eingebüßt, weil die neuen Techniken zur so genannten Bekämpfung innenpolitischer Auflehnungen und Revolten Politiker in vielen Ländern zur Klärung der Frage, was Folter, was Misshandlung und was legitime Gewalt des staatlichen Monopols sei, veranlasst hat. Zu den neuen Techniken zählen solche, die mit Schall- und Mikrowellen oder mit Elektroschockern und Klebstoffen operieren. Ihre Untersuchung in Laboren und eine Freilanderprobung sind weit vorangeschritten und werden von einer Öffentlichkeit kaum beachtet. Terrorattacken weiten sich aus, und der „Krieg gegen den Terror“ wird angeblich reaktiv immer weiter ausgedehnt. Eine Rüstungsspirale ist längst in Gang gekommen, die widerständiges Verhalten einkreist. Die Debatte um Folterungen in Irak und an anderen Orten und die damit verbundene Aufweichung der Kriterien, die Folterhandlungen zu relativieren versuchen, macht eine Neuaufnahme der Diskussion notwendig, die sich nicht allein unter juristischen Experten abspielen darf. Denn es gibt nach meiner Auffassung keine Unterscheidung zwischen Misshandlung und Folter, sieht man einmal vom Status der Täter ab, was für die Folgen bei den betroffenen Opfern kaum Relevanz erzeugt.