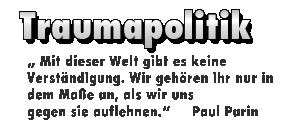Die bedeutsame und unbeantwortete Frage lautet, welches denn die vor dem Auslandseinsatz vorhanden gewesenen Störungen waren, die ein erhöhtes Risiko für später auftretende posttraumatische Belastungsstörungen repräsentieren. Aus den zusammenfassenden Berichten für eine Pressekonferenz wird lediglich „Grübelneigung“ als vorausgegangene Störung genannt. Ja, als Soldat ist Grübeln über den Sinn des Einsatzes hinderlich. Je mehr so genannte Störungen in den einschlägigen Manualen genannt werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine später auftretende PTBS mit solchen Störungen in eine kausale Verbindung zu bringen. Eine logische Beziehung zwischen den Störung genannten Eigenschaften eines Soldaten und einem dauerhaften Leiden an posttraumatischen Symptomen ist nicht herzustellen, wenn nicht unterstellt wird, dass die früheren Störungen eine erhöhte Vulnerabilität für extreme Erlebnisse im Auslandseinsatz verursachen. Dies ist jedoch vorerst eine bloße Annahme. Hier ist zu fordern, dass biographisch den Ursachen und Anlässen für frühere Störungen nachgegangen und belegt wird, inwiefern frühere Störungen (als Folgen traumatischer Erlebnisse?) das Risiko für PTBS drastisch erhöhen und, wie die Querschnittsstudie nahe legt, an aus Auslandseinsätzen zurückgekehrten Soldaten andere einsatzbedingte psychische Störungen diagnostiziert werden können, die die Rate von PTBS um ein Mehrfaches übersteigen. Insgesamt konnten bei Soldaten und Soldatinnen nach dem Afghanistan-Einsatz rund 20% als psychisch gestört bestimmt werden, das Risiko einer Neuerkrankung steigt durch den Auslandseinsatz um das Vier- bis Sechsfache.
Die Zahl der Behandlungen wegen Symptomen, die einer PTBS zugeordnet wurden, stieg in den Jahren 2007 (149), 2008 (245), 2009 (466) bis September 2010 auf 483. Bei diesen Zahlen handelt es sich nicht um umfangreiche Therapien, auch einmalige Kontaktaufnahme mit einem Experten rechnet zu den „Behandlungen.“ Auf der Seite der professionellen Therapeuten finden sich zahlenmäßig erhebliche Mängel: Von 42 Dienstposten für Psychiater waren nur 24 besetzt.
Eine der Kernaussagen der Querschnittsstudie lautet, dass die kumulierte Gesamtzahl an PTBS-Erkrankten seit Beginn der deutschen Auslandseinsätze in die Tausende gehen dürfte. Dabei bleibt, dieser Dunkelziffernstudie zufolge, jeder zweite PTBS-Fall diagnostisch unerkannt und unbehandelt, was einer Dunkelziffer von 45% entspricht. Diese Zahl wird ermittelt, indem sie aus jener Zahl von Soldaten mit der Diagnose PTBS abgeleitet wird, die nicht um Beratung oder Therapie nachsuchen. Das erscheint offenbar nur statistisch logisch. Es handelt nach eigener Aussage der Autoren bei der „möglichen Dunkelziffer“ um Schätzzahlen.
Als heikel stellt sich die Bestimmtheit dar, mit der einsatzbedingte psychische Störungen wie Depressionen, Schlafstörungen (sic!) und Fatigue auf Besonderheiten des Einsatzes bezogen werden und mit verblüffender Sicherheit von PTBS abgegrenzt werden. Auch hier muss man feststellen, dass eine Differentialdiagnose kaum zu treffen ist, wenn man PTBS als Prozess und nicht als Momentaufnahme auffasst und nur sehr künstliche (willkürliche) Kriterien eine Differenzierung gestatten. Diese Kriterien werden freilich nicht ausgewiesen. Dies erzeugt den Eindruck einer Diagnostik nach Fragekatalog, weil es sich gerade bei den angeführten sonstigen psychischen Störungen und ihren Erscheinungsbildern um Elemente der PTBS handeln kann. Andere Vorschläge von anderen Autoren liefen auf so genannte „partielle PTBS“ hinaus, was auch geeignet ist, die präzise Differentialdiagnose zu ersparen.
Als Schwachpunkte solcher Studien sind abschließend festzuhalten:
1) Die Herauslösung der Diagnose PTBS aus ihren mitverursachenden Großkontexten,
2) Die mangelhafte differentialdiagnostische Präzision,
3) Die willkürliche Erweiterung traumatischer Ereignisse um einsatzbegleitende Ereignisse,
4) Die retrospektive Behauptung psychischer Störungen vor dem Auslandseinsatz,
5) Die Schwierigkeiten, für Soldaten gesundheitliche Risikoanalysen zu erstellen.
Wenn man bei Soldaten von einer potenziell verletzenden Wirkung durch die Konfrontation mit dem Tod und durch das Risiko der eigenen Auslöschung ausgeht, dann kann man sie nur im äußersten Notwehrfall zur unmittelbaren Landesverteidigung einsetzen, nicht aber bei Abenteuern mit ungewissem Ausgang und unzureichender Zielsetzung. Die Politik macht sich in solchen Fällen der Beihilfe zur seelischen Verkrüppelung schuldig.
Redundanzen bitte ich zu entschuldigen.