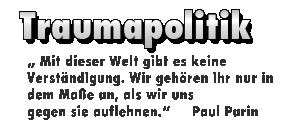Bilder, Zensur, Urteile und die Macht der Psychiatrie/Therapeuten
Sepp Graessner, – Oktober 2006
Bilder, Zensur, Urteile und die Macht der Psychiatrie/Therapeuten
(für M.)
Im Jahre 1997 hatte sich im Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin eine Tendenz zur Hierarchie herausgebildet. Sie wurde als natürlicher Ausdruck eines schon zuvor entwickelten Machtwillens hingenommen. Die Bildung von Hierarchien berief sich auf therapeutische Erfahrung mit traumatisierten Flüchtlingen und meinte eher die Dauer der Zugehörigkeit zur Einrichtung. Diese Art von „Natürlichkeit“ war mir stets suspekt. Hierarchie bedeutet Machtkonstellationen in der interpersonalen Kommunikation; dies ist ein Kennzeichen von Institutionen. Dazu zählt auch das wortlose Streichen von Textpassagen von Mitarbeitern. Ohne Fragen und Diskussion wandert der Cursor von Vorgesetzten über den Computer und löscht Wörter, Sätze, Bedeutungen von Kollegen. Das habe ich als Ausdruck von Machtspielen, als Kränkung empfunden. In der betreuenden und unterstützenden Tätigkeit ging es neben institutionsdynamischen Aspekten dabei nach meiner Beobachtung immer zugleich um die Rolle und Bedeutung eines breit verankerten und expandierenden Diskurses vom Psychotrauma, um die Wahrheit des einzig richtigen Urteils und sicher auch um einen universellen Aufruf zum sensiblen Umgang mit anderen Menschen. Es ging ferner um taktische und erzieherische Überlegungen und die Produktion eines pathetischen Bildes von der Arbeit im öffentlichen Raum, mit der sich Mitarbeiter den Grausamkeiten der Welt aussetzten. Das Motiv der Sicherung eines Arbeitsplatzes zur Spezialisierung und Weiterbildung im therapeutischen Sektor will ich nur marginal erwähnen.