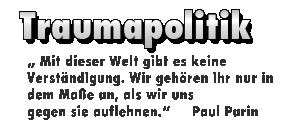Wozu Erkenntnis? Das Trauma liegt auf der Hand! (2016/2019)
Dieser kleine Beitrag versucht eine Antwort auf die Frage, warum schmerzliche Erlebnisse mit psychischen, d.h. traumatischen, Folgephänomenen die so zahlreich sind wie die Varianten des Schachspiels und öfter und regelmäßiger auftreten als Kälte am Polarkreis, erst am Ende des 20. Jahrhunderts zu einer Systematik der Symptome und damit zu einer Anerkennung einer Diagnose durch Laien und Fachleute geführt haben: dem Psychotrauma und der posttraumatischen Belastungsstörung. In diesem Bereich subjektiver Wahrnehmungen wurde nun intensiv geforscht. Die Wissenschaft der US-Psychiatrie nahm sich der Subjektivität an. Dazu benötigte sie einen theoriefreien Pragmatismus, Beobachtungen in Veteranenhospitälern und jonglierende Biostatistiker. Was nahezu alle Menschen des Erdballs kennen und worüber sie sich eine Meinung gebildet haben, weil sie sich geschwächt, ängstlich, traurig, gequält fühlen, wird ihnen von der westlich inspirierten Wissenschaft abgenommen und in neue Zusammenhänge des Verständnisses eingefügt, das in einer akademischen Aus- und Weiterbildung erworben werden kann.
Vermutlich hat die Monopolstellung der Kirchen diese neue Betrachtung von Psyche lange Zeit verhindert. Wenn man in den Kirchen davon ausging, dass auch Unheil, Schmerzen, Verluste dem Wirken Gottes unterliegen, dann ist die Betrachtung psychischer Leiden als durch die soziale und feindliche Umwelt verursacht ein ketzerischer und revolutionärer Gedanke, der am Kernanliegen der Allmacht Kratzer hinterlassen konnte und daher seit Jahrhunderten bekämpft wurde. Kein Monopol gibt kampflos auf. Aber nicht nur die beschädigte Psyche wollte die Aufklärung den Kirchen entreißen, auch die subjektiven und weitgehend verborgenen Gefühle, die zu Motiven für widerständiges oder kriminelles Handeln werden konnten, reizten die beginnende Forschung mit Billigung und im Interesse der Origkeit. Beziehungen unter Menschen und Bindungen zwischen ihnen forderten die Suche nach Kriterien für Vertrauen, Patriotismus, Treue und Zuverlässigkeit heraus. Sicher ist auch anzunehmen, dass in Zeiten von Hunger und Missernten, hoher Kindersterblichkeit, übertragbaren Krankheiten, täglicher Überlebensarbeit und vielen weiteren Beschränkungen das Reden über psychische Prozesse als Trauma als randständiges Geschwätz abgetan wurde und keine Priorität beansprucen durfte, obwohl diese Prozesse zu allen Zeiten im Hintergrund wirkten und sehr zögerlich als traumatische Erlebnisse in den Vordergrund drängten, aber allzu lange Projektionen begünstigte.
Diese traumatisch wirkenden Einflüsse brachten jedoch ein favorisiertes und von höchster Stelle gefördertes Abwehrsystem gegen psychologische Erklärungsmuster hervor, das als Männer- und Heldenbild unausrottbar schien. In quasi militarisierten Gesellschaften durchzog dieses Bild alle Bereiche des Alltags. Man konnte sich dem nur schwer entziehen. Es wurde zum allgemeinen Maßstab der Selbstdefinition. Bei solchen Helden und Männern konnte man nur Spott ernten, wenn man vereinzelt auf vulnerable Anteile in Menschen hinwies. Die innewohnende Gewalt dieses Männerbildes wurde durch die Lächerlichmachung von psychischen Verletzungen gleich mit abgewehrt. Frauen kamen nur insofern vor, als sensible Männer als weibisch diffamiert wurden.