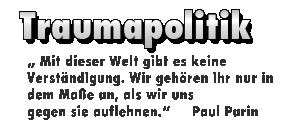von Sepp Graessner
Wir sind Zeugen einer symbolischen Revolution, die sich mit den Begriffen „Trauma, PTBS, traumatisches Gedächtnis und therapeutische Angebote für Traumatisierte“ verbindet. Es wird der Eindruck erweckt, traumatische Erlebnisse würden das Leben von Traumatisierten vergiften, wenn sie nicht in therapeutischen Settings kommuniziert und damit entschärft würden. Es stellt sich hier die Frage, wie lange das Leiden an der traumatischen Erinnerung andauern kann und darf, ob also Prognosen über den Verlauf posttraumatischer Symptomatik nach bisheriger Erfahrung abgegeben werden dürften, die zumindest Reste von Hoffnung zulassen und Resignation und Regression vorbeugen.
In einem Grußwort anlässlich eines Symposiums in Hamburg, das sich mit Staatsterrorismus und psychosozialer Gesundheit in Südamerika befasste, hatte 1989 Adriaan van Es [1] darauf hingewiesen, dass die Diagnose PTBS deshalb als unzureichend betrachtet werden müsste, weil sie die Fortdauer des inneren Terrors hinter der Vorsilbe „post“ verstecke. Vielmehr sei, z.B. in Südafrika, von einem CTSD, einem „Continuing Trauma“ zu sprechen, wie Lloyd Vogelman [2] vorschlug. Van Es bezog sich auf die Leidtragenden des Apartheidsystems in Südafrika, und er forderte in seinem Statement dazu auf, dafür Sorge zu tragen, dass Verfolgte und Misshandelte aus politischen Kontexten in ihren Heimatländern behandelt werden sollten und spezifische Wege der Behandlung gefunden werden müssten, die den Anforderungen und Vorgaben der regionalen Kulturen entsprechen. Über 25 Jahre sind seither vergangen, und die verzweigten, nicht selten utilitaristischen Entwicklungen des Traumadiskurses haben Fragen aufgeworfen. An einige Antworten habe ich mich als Skeptiker in meinen Gedankensplittern genähert, als Bilanz meiner praktischen Tätigkeit.
Wenn man der Äußerung van Es’ folgt, können Mut und Hoffnung vergehen, denn die Bedeutung des „Continuing Trauma“ sieht eine Linderung und strukturelle Verbesserung nicht vor oder legt sich nicht fest; vielmehr verallgemeinere dieses Verständnis jene Fälle, die unter dauerhafter Symptomatik litten und übertrage sie auf alle Menschen, die einem extremen Trauma ausgesetzt waren. Der traumatische Einschlag finde somit bei allen Betroffenen keinen Abschluss und führe ein Eigenleben mit einem autogenerierenden Mechanismus. Erinnerung ans Trauma und posttraumatische Symptome seien nur in inniger Verbindung zu denken (vom Therapeuten) und zu fühlen (vom Traumatisierten). Das Hauptsymptom eines demütigenden Traumas wäre demnach die bewusst oder unbewusst generierte Erinnerung, was Allan Young schon zu Beginn der 1990er Jahre erkannte. Wenn aber mit „continuing“ der prozesshafte Charakter posttraumatischen Befindens gemeint ist, dann können wir leichter folgen, weil jeder Prozess irgendwann ein Ende hat oder zumindest durch kommunikative Interventionen abzukürzen ist. Die Vorstellung gleichsam toxischer Erlebnisse, deren Toxizität nicht abnimmt oder von Zeit zu Zeit heftig aufwallt, ist nicht haltbar, wenn man die Mehrheit traumatisierter Menschen betrachtet, die offenbar ihr persönliches „Antitoxin“ (mit Hilfe Dritter) gefunden haben, auch wenn man nicht sicher sagen kann, wie sie das angestellt haben. Denn die Entwicklung einer psychischen Biographie (im Unterschied zur formalen, Ereignis gestützten) enthält so viele Ressourcen, Variablen und verarbeitete Sinneseindrücke, dass man nicht prognostizieren kann, wann eine sauber diagnostizierte psychosoziale Störung einer extrem traumatisierten Person persistiert, abklingt oder in Vergessenheit sedimentiert. Diese vielfältigen und unterschiedlich gewichteten Kraftfelder lassen sich in keiner Statistik anführen, weil man in Statistiken Subjektivität und Dynamik nicht berechenbar darstellen kann. Wer sich trotz traumatischer Erlebnisse nicht krank fühlt, taucht in keiner Befragung oder Statistik auf. Selbst wenn man in quantitativer Weise biographische Risikofaktoren bewerten könnte, ist eine Prognose wegen der kommunikativen Einflüsse aus der posttraumatischen Umgebungsgesellschaft Illusion.