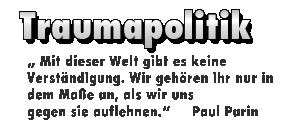Einundzwanzigster Einwurf
„PTSD continues to serve a political purpose.“ ( Blog Fred C. Alford zu Trauma und PTSD, Januar 2017)
Zur posttraumatischen Belastungsstörung, zur somatischen Symptom-Störung (SSD) oder heute: somatische Belastungsstörung sowie weiteren seitenfüllenden Diagnosen im DSM-5, die mit Definitionen als Entdeckungen auftauchen, aber in dialektischer Weise wohl eher die Entdecker definieren, sollen hier einige Überlegungen ausgebreitet werden, die mich ins Grübeln versetzt haben. Besonders die SSD nimmt eine Stellung im DSM ein, die methodisch und von der Zuordnung etliche Fragen aufwirft. Es geht bei etlichen Diagnosen im DSM-5 um Sachverhalte, die scheinbar auf der Hand liegen und daher keinen Zweifel zulassen. Und was auf der Hand liegt, kann nicht nur von Zauberern zum Verschwinden gebracht werden. Manchmal reicht genaues Beobachten und das Befragen von Begriffen.
Beginnen wir mit einem Ausschnitt aus einem Abstract von 9 Autor*innen: It... (somatic symptom disorder, S.G.) „defines the disorder on the basis of persistent somatic symptoms associated with disproportionate thoughts, feelings, and behaviors related to these symptoms.“ Folgende Autor*innen, von denen ein Großteil aus dem biostatistischen Hause stammt, übernehmen die Verantwortung:
Dimsdale JE, Creed F, Escobar J, Sharpe M, Wulsin L, Barsky A, Lee S, Irwin MR, Levenson J. schreiben dies in ihrem 2013 veröffentlichten Artikel „Somatic symptom disorder: an important change in DSM“. (Journal of Psychosomatic Research, 75 (3) S. 223-228.)
Hier wird ziemlich wörtlich übernommen, was Robert L. Spitzer 38 Jahre zuvor im American Journal of Psychiatry 1975 132:11, 1187-1192 in einem Aufsatz:„Clinical criteria for psychiatric diagnosis and DSM-III“ formuliert hatte, wenn auch in einem anderen Zusammenhang und wohl auch zu einem anderen Zweck. Er meinte u.a. auch PTSD, der er eine somatische Grundlage/Folge unterstellte. Er schrieb: