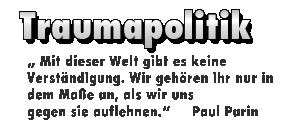Gedanken zu Edward Erdos: Die Milgram-Falle
von Sepp Graessner
In der „Psychosozial“ (33. Jg. (2010) H.2 (Nr. 120), S.85-101) bietet Edward Erdos eine alternative Betrachtung des Milgram-Experiments zur Gehorsambereitschaft gegenüber Autorität, indem er die modifizierte Replikation des Experiments (unter aktuellen ethischen Bedingungen) durch Jerry Burger (2009) interpretiert. Der Aufsatz trägt den bezeichnenden Titel: „Die Milgram-Falle“. Die Grundzüge des Experiments werden als bekannt vorausgesetzt.
Die Ergebnisse des modifizierten Experiments, so Erdos, „lassen auf eine in uns allen schlummernde, angeborene Fähigkeit zur Unmenschlichkeit (?) schließen, die von sozialen Kräften unserer Umgebung ganz leicht geweckt werden kann, zum Beispiel von einem Mann im weißen Kittel.“ (S. 85) „Die Macht der situativen Kräfte“ (was immer diese definiert) veranlasse Probanden, sich den Anweisungen des Versuchsleiters zu fügen. Erdos ist offenbar durch zwei Textstellen bei Milgram bzw. Burger beeinflusst: einmal durch Milgrams Aussage, dass während des Experiments emotionale Spannungen bei einzelnen Probanden zu beobachten waren, die Erdos als „extremen Stress“ deutet, zum anderen durch einen Dialog zwischen einem Probanden und dem Versuchsleiter, in dem der Proband wiederholt Bedenken gegen eine Fortsetzung des „vorgeschriebenen“ Prozedere äußert, sich aber gleichwohl zur weiteren Stromapplikation bereit findet. Die Schreie des „bestraften Schülers“ hatten beim widerstrebenden Probanden Empathie hervorgerufen, waren aber durch intensive Ansprache des Versuchsleiters endlich zerstreut worden. Die Empathiebereitschaft nahm in dem Maße zu, je geringer die Distanz zum gepeinigten „Schüler“ wurde. Die Gehorsamsbereitschaft habe von 60% bei großem Abstand des „gequälten“ Schülers auf 20% abgenommen, wenn sich der stöhnende oder schreiende, stromdurchzuckte Schüler im gleichen Raum befand. Dies sei ein Beleg für wachsende Empathiebereitschaft, wenn die Distanz zum „Opfer“ abnehme.