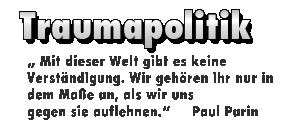Das Wort Opfer, einzeln oder in Zusammensetzungen, kommt uns leicht und locker von den Lippen. Doch was bewirkt dieser Inbegriff von Passivität, von Schlachtung, Folter und Verletzung, von Zufall und gesellschaftlicher Intention, wenn er sich erst einmal in unserem Inneren als Automatismus sedimentiert hat? Und wohin verästelt sich ein solcher Begriff, dass wir seine ursprüngliche Bedeutung nicht mehr bewusst wahrnehmen, obschon er Wirkungen in unserem Unbewussten entfaltet, also Teil unseres Unbewussten wird und hier das Schicksal von Sprache teilt?
Folteropfer ist eine solche Zusammensetzung, und sie wird global täglich mehr als tausendmal benutzt. So auch im Behandlungszentrum für Folteropfer in Berlin, das sich vor längerer Zeit entschlossen hat, den Opferbegriff durch das Wort „Überlebender“ zu ersetzen. Wie schwer diese Umbenennung fällt, davon zeugt der Gebrauch des Begriffs „Folteropfer“, wenn es um Gutachten und Stellungnahmen für Behörden und Gerichte geht. Mit dem Wort „Opfer“ können leichter Affekte ausgelöst werden, wenn es nur nicht die abstumpfende, inflationäre Zunahme von Opfern gäbe: Flutopfer, Erdbebenopfer, Stasi-Opfer, Verkehrsopfer, Verbrechensopfer, Kriegsopfer, Vertreibungsopfer, Scheidungsopfer, Justizopfer, ja Liebesopfer oder allgemein: Krisenopfer usw. Früher soll es auch Menschenopfer gegeben haben. Die modernen Kriege verursachen keine Menschenopfer, sondern Kollateralschäden. Das Notopfer, z.B. als Briefmarke, weist einen anderen Charakter auf. Es wird gefordert, um eine Krise abzuwenden oder zu mildern und eine gewisse Gleichheit zu suggerieren. Insgesamt lässt sich sagen: Jeder Mensch ist in seinem Leben mehrfach Opfer geworden. Und insofern könnten wir uns als universelle Selbsthilfegruppe organisieren. Dazu wäre allerdings reduktionistisch der alle Opfer verbindende Anteil zu isolieren und zu beschreiben. Eine neue Anthropologie auf der Basis des Opferdaseins scheint einer Hoffnung verbreitenden Entwicklung wohl eher entgegenzustehen. Opfersein hat so etwas Bestimmendes, Endgültiges und Unverrückbares, wenn wir nicht fröhlich sagen könnten, alle Menschen sind Opfer. Aber dazu sind wir nicht bereit, obwohl wir täglich beobachten, dass ein individuelles Gewaltopfer immer auch die Gesellschaft affiziert und durch Identifikation neue Opfer produziert..