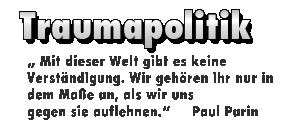„Wir“ und „Ich“ bei kurdischen traumatisierten Flüchtlingen – Eine Annäherung
Eine bohrende Frage hat sich gestellt: Benutzen Kurden als Einzelklienten, wenn sie ihre Erlebnisse von Verfolgung und Misshandlung berichten, das „Wir“, weil sie in ihrer primären, großfamiliären Sozialisation zu einem Denken und Fühlen im Wir erzogen wurden oder weil sie in einer politischen Organisation eine Wir-Identität (sekundäre Sozialisation) ausbildeten, d.h. Anteile ihres Ichs an ein Wir zu delegieren gezwungen waren, oder wollen sie mit dem Wir zum Ausdruck bringen, dass sie ihre Erlebnisse verallgemeinern können, da viele Menschen wie sie betroffen sind? Das lässt sich nicht ohne weiteres beantworten, da man nur die Auswirkungen eines möglicherweise kollektiven Denkens, Fühlens und Wünschens erfassen kann. Ursachen und Steuerungsmechanismen bleiben dunkel. Wie viel kurdische Identität (als Konstruktion und Reaktion) steckt in dem gebrauchten Wir? „Wir Kurden haben keine Freunde,“ lautet ein oft gehörter Satz. Zuerst glaubt ein Zuhörer, der Gebrauch des Wir sei ein Zeichen von Bescheidenheit, von Konventionen, mit denen ein Ich vor dem Wir zurücktritt. Vielleicht sind auch all diese Einflüsse im kurdisch verstandenen Wir enthalten.